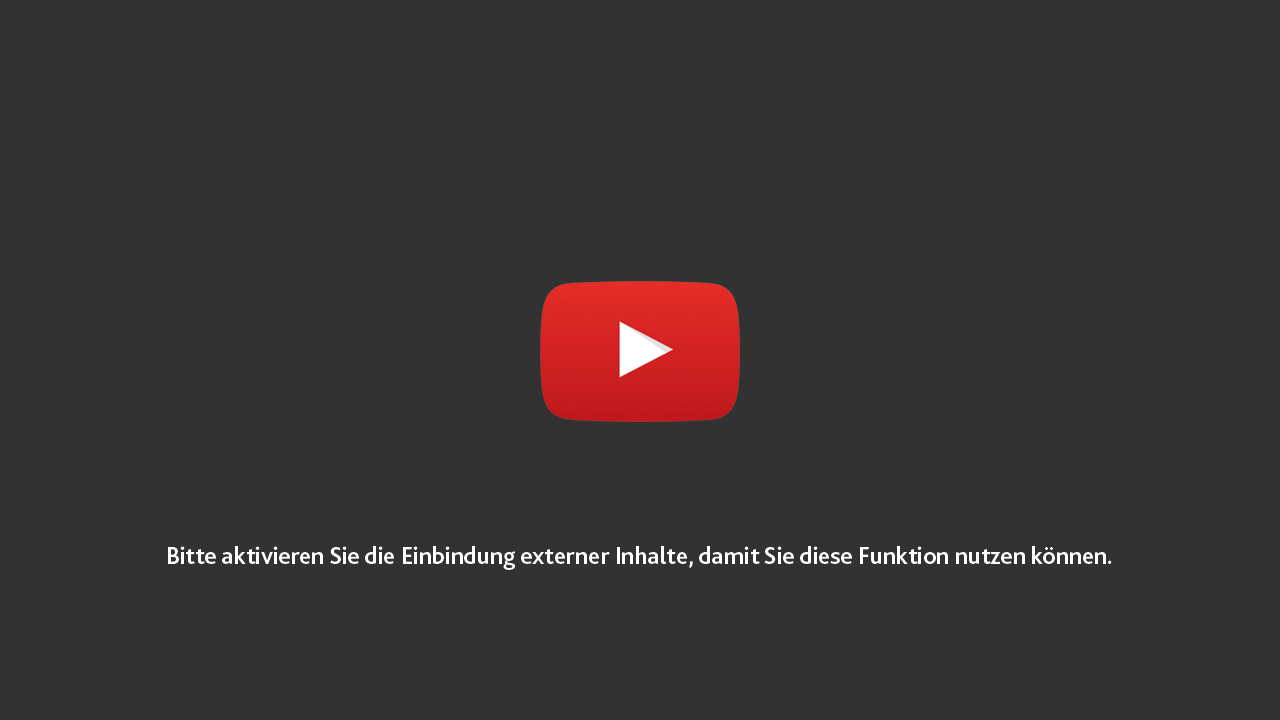Organspende
Das Alter spielt keine Rolle

Trotz der grundsätzlichen Bereitschaft der Deutschen zur Organspende ranken sich um diese zahlreiche Mythen. Die Skandale von 2012 um einzelne Transplantationszentren taten ihr Übriges. Grund genug, um auch an dieser Stelle über Organspende aufzuklären. Zum Beispiel über die Frage: Bin ich für die Organspende nicht viel zu alt?
Viele ältere Menschen glauben, sie seien für die Organspende zu alt. Doch genauso wie es kein Mindestalter für die Organspende gibt – für Kinder unter 14 Jahren entscheiden die Eltern –, so gibt es auch keine Höchstgrenze. Entscheidend ist der Gesundheitszustand der verstorbenen Person und der Zustand ihrer Organe. Dabei wird auch das biologische Alter der Spender und Organe berücksichtigt, weshalb ältere Personen häufig die Organe älterer Spender erhalten.
Gerade unter den Herzpatienten ist das Alter eher hoch, weshalb auch hochbetagte Herzen als Spende angenommen werden. Allerdings nur, sofern keine Vorerkrankung am Organ vorliegt. Bei einer OP an der Herzklappe, einem Bypass oder bei einem oder mehreren Stents wäre dem Empfänger nur wenig geholfen.
Als Frank-Walter Steinmeier seiner Frau Elke Büdenbender im August 2010 eine Niere schenkte, war er 54 Jahre alt und konnte bereits 9 Tage später wieder das Krankenhaus verlassen. Die Niere ist dabei das am häufigsten für eine Transplantation benötigte Organ. Ende 2020 standen allein in Deutschland über 7000 Menschen auf der Warteliste, fast 2000 Nieren wurden im selben Jahr verpflanzt, ein knappes Viertel davon als Lebendspende.
Lebendorganspenden
In Deutschland werden vorwiegend Niere und Teile der Leber als Lebendspende akzeptiert, und auch diese nur unter sich nahestehenden Angehörigen. Dass die Spende unter absoluter Freiwilligkeit und ohne jede finanzielle Anreize passiert, wird in psychologischen Vorgesprächen überprüft. Der Rücktritt vom Spendenangebot ist jederzeit möglich.
Postmortale Organspende
Die wichtigste Voraussetzung für eine Organspende nach dem Tod ist die Zustimmung zur Weitergabe der eigenen Organe oder, sollte keine diesbezügliche Entscheidung vorliegen, die Zustimmung der nächsten Angehörigen. Hinzu tritt der seltene Umstand eines endgültigen Ausfalls sämtlicher Hirnfunktionen, des Hirntodes. Erst dann wird geprüft, ob eine Transplantation einzelner Organe sinnvoll ist. Folgende Organspenden sind generell möglich:
- Nierentransplantation
- Lebertransplantation
- Herztransplantation
- Lungentransplantation
- Bauchspeicheldrüsentransplantation
- Dünndarmtransplantation
Gewebespende
Anders als bei der Organspende können Gewebeteile noch bis zu 72 Stunden nach Zusammenbruch des Herz-Kreislauf-Systems gespendet werden. Zudem ist die Gewebespende mit weniger Komplikationen wie Abstoßungsreaktionen beim Empfänger verbunden. Dennoch hat die Organspende gegenüber der Gewebespende Vorrang. Typische Gewebespenden sind:
- Hornhaut der Augen
- Herzklappen
- Blutgefäße
- Haut
- Knochen-, Knorpel- und Weichteilgewebe
Wann ist eine Organspende ausgeschlossen?
Bei allem guten Willen der Spender ist eine Weitergabe eigener Organe beispielsweise auch nach dem Tod ausgeschlossen, wenn der Spender unter einer akuten Krebserkrankung litt oder HIV-positiv war. Die Risiken für den Empfänger sind hierbei zu hoch. Viele Krankheiten sind jedoch kein Hinderungsgrund, weshalb erst nach dem Tod und im Einzelfall eine Transplantation geprüft werden kann.
Aufgrund der extrem hohen Nachfrage und dem dazu verhältnismäßig geringen Angebot werden inzwischen auch Organspenden von Risikopatienten, beispielsweise von Rauchern oder Menschen mit Bluthochdruck angenommen.
Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende
Zum März dieses Jahres trat das Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende in Kraft. Es sieht die Einrichtung eines bundesweiten Online-Registers beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) vor als auch die Möglichkeit eines breitangelegten und ergebnisoffenen Beratungsangebotes beim Hausarzt, in den Erste-Hilfe-Kursen zum Erwerb der Fahrerlaubnis sowie Aufklärungsmaterial bei den Ausweisstellen von Bund und Ländern. Hintergrund ist die große gesellschaftliche Akzeptanz der Organspende, aber die häufig fehlende dokumentierte Entscheidung dafür aufgrund einer unzureichenden Aufklärung.
Die eigene Entscheidung dokumentieren
Die Organspendebereitschaft ist groß. 82 Prozent der Deutschen stehen der Organ- und Gewebespende positiv gegenüber. Doch nur 62 Prozent der Befragten haben eine persönliche Entscheidung dafür oder dagegen getroffen und nur 44 Prozent haben diese Entscheidung tatsächlich dokumentiert. Ohne schriftliches Festhalten der eigenen Wahl in einem Organspendeausweis oder einer Patientenverfügung kann jedoch nach deutschem Gesetz im Falle eines Falles kein Organ und kein Gewebe entnommen werden, beziehungsweise müssen die Angehörigen darüber schweren Herzens entscheiden.
Deshalb ist es notwendig, die eigene Entscheidung auf einem Organspendeausweis festzuhalten. Das kann der typische Plastikausweis im Scheckkartenformat sein, die Variante auf Papier oder der Ausdruck eines Onlineformulars. Wichtig ist, ihn immer bei sich zu tragen, dass er schnell auffindbar ist und er klar die Entscheidung für oder gegen die Organ- oder Gewebespende dokumentiert. Für einen Auslandsaufenthalt ist es ratsam, einen Organspendeausweis in der entsprechenden Landessprache oder zumindest in Englisch mitzunehmen. Eine komfortable Gegenüberstellung der deutschen und der fremdsprachigen Version auf dem Ausdruck hilft beim Ausfüllen.
Niemand ist vor Krankheit oder Unfall gefeit und so kann früher oder später auch jeder auf eine Transplantation angewiesen sein. Die Wahrscheinlichkeit ist jedenfalls deutlich höher, irgendwann ein Spenderorgan zu benötigen als Organspender zu werden.