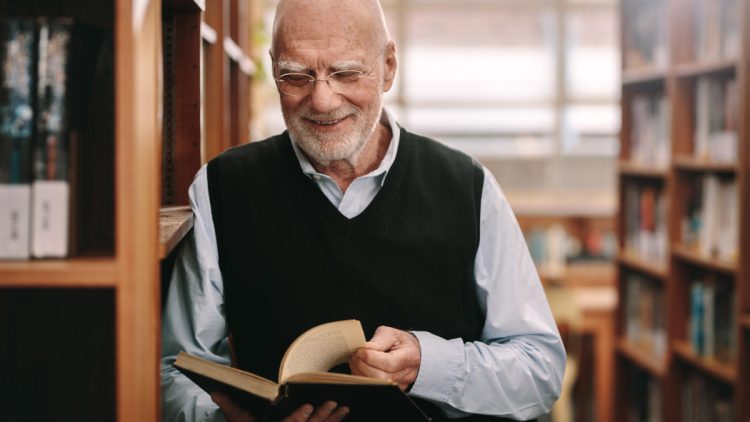Altsein früher und heute: Veränderungen des Altersbildes in unserer Kultur

Früher galten Menschen ab 60 Jahre als hochbetagt – inzwischen hat sich das nach hinten verschoben. | © Azeemud/peopleimages.com – stock.adobe.com
Wer gilt als alt und was bedeutet „alt sein“ eigentlich? Diese Frage beantworten sich Menschen und Gesellschaft heutzutage deutlich anders als früher. Wenn Sie auf das Altersbild der Antike blicken oder nur auf das aus den 1950er Jahren, erkennen Sie vielleicht Aspekte wieder, doch widersprechen diesen wahrscheinlich in zentralen Punkten. Hier erklären wir Ihnen, wie sich die Identität der Senioren in den Jahrhunderten gewandelt hat und warum.
Altsein früher: Ein Rückblick
Nicht nur das Altersbild unterschied sich in früheren Zeiten von unseren aktuellen Vorstellungen; ältere Menschen waren auch zahlenmäßig nicht so präsent in der Gesellschaft.
Im antiken Rom erreichten beispielsweise nur 5 bis 8 Prozent der Bevölkerung ein Alter über 60, während Senioren dieser Altersgruppe heute in Deutschland über 25 Prozent ausmachen. Gerade in den vergangenen Jahrzehnten trug die steigende Lebenserwartung entscheidend zu diesem Umbau der Gesellschaft bei.
Noch im Jahr 1950 betrug die durchschnittliche Lebenserwartung einer deutschen Frau rund 68 Jahre, während es heute 83 Jahre sind und für das Jahr 2070 eine Lebenserwartung von 88 Jahren prognostiziert wird. Die Altersklischees vergangener Epochen muss man daher vor dem Hintergrund betrachten, dass es deutlich weniger alte Menschen gab und man bereits ab 60 Jahren als hochbetagt galt.
Wie stand es früher um den Gesundheitszustand älterer Menschen?
Relativierend muss gesagt werden: Die Steigerung der durchschnittlichen Lebenserwartung beruht nicht nur auf einer besseren Gesundheit im Alter, sondern auch auf der gesunkenen Kindersterblichkeit.
Sie betrug in den 1950er Jahren immerhin noch 97 Todesfälle pro 1.000 Säuglinge, während sie sich heute auf 3 Fälle pro 1000 Geburten reduziert hat. Darüber sieht man die Gründe für ein wachsendes Lebensalter vor allem in höheren Hygienestandards und der besseren medizinischen Versorgung von Infektionen und chronischen Krankheiten.
Länger fit und schmerzfrei
Gegenüber früheren Jahrhunderten können Senioren heute wesentlich länger ihren guten Gesundheitszustand genießen. Gerade in antiken und mittelalterlichen Porträts sowie frühen Fotografien wird deutlich, was Alter in den vorangehenden Jahrhunderten für den Körper bedeutete: Sie zeichnen ein Bild von Zahnverlust, verkrümmten Knochen und schweren Haltungsschäden – häufig Spätfolgen einer Mangelernährung in der Kindheit.
Die Generation der Babyboomer dagegen erlebte ihre Kindheit und ihr Erwachsenendasein in einem Umfeld ohne Mangel und mit guter medizinischer Versorgung, sodass sie für das gesunde Leben mit 65Plus weitgehend die richtigen Grundsteine gelegt haben.
Welches Bild vom Alter gab es früher in anderen Lebensbereichen?
1. Politik
Gerade in antiken Gesellschaften übten ältere Männer den entscheidenden Einfluss aus. So wurden Politiker im entscheidenden Rat der Stadt Sparta, der „Gerusia“, erst ab einem Alter von 60 Jahren aufgenommen. Im alten Rom konnte man ebenfalls nur im Anschluss an eine vollständig durchlaufene Beamtenkarriere in den Senat eintreten, was ebenfalls mit höherem Lebensalter einherging.
Die Römer respektierten die lange Lebenserfahrung so sehr, dass sie dem Familienpatriarchen lebenslang die juristische Entscheidungsgewalt über seine Kinder ließen. So musste ein erwachsener Sohn den Vater bei privatrechtlichen Fragen immer noch um Zustimmung bitten – selbst wenn der Spross bereits 50 Jahre alt war und sein Vater 75.
2. Schönheitsideale
Jugend wird mit Schönheit gleichgesetzt – was wir in unserer heutigen Gesellschaft manchmal beklagen, galt bereits in der Antike und im Mittelalter. Helden und erfolgreiche Politiker wurden in offiziellen Porträts stets kraftvoll und jugendlich dargestellt, selbst wenn sie bereits ein hohes Alter erreicht hatten.
Im Gegensatz dazu diente gerade in der griechischen Kunst die überzeichnete Darstellung des gebrechlichen Greises der allgemeinen Belustigung. Bei Frauen wurden Altersmerkmale in künstlerischen Darstellungen weitgehend ignoriert: Porträts auf römischen Grabsteinen zeigen, dass die Bildhauer den Verstorbenen wieder das Gesicht einer 20-Jährigen verleihen.
Genauso diente die Kleiderordnung des Mittelalters dazu, weibliche Alterungsprozesse weitgehend zu kaschieren: Ab 40 trug Frau eine Haube, Schleier und lange dunkle Kleidung, um möglichst wenig aufzufallen.
3. Versorgung und Pflege
Wer in antiken Gesellschaften aus Altersgründen nicht mehr aktiv am Arbeitsleben teilnehmen konnte, war auf die Versorgung durch die Familie angewiesen. Konkret kümmerten sich meist die Kinder um ihre Eltern, was etwa im Athen der klassischen Periode durchaus öffentlich kontrolliert wurde. Hier durfte sich nur jeder in die Volksversammlung wählen lassen, der nachweisen konnte, dass er seinen Eltern ein gutes Leben im Alter ermöglichte.
Über die Jahrhunderte funktionierte dieser Generationenvertrag natürlich nur bei Familien mit einer entsprechend hohen materiellen und gesellschaftlichen Stellung. Eine Wende für die schwächeren sozialen Schichten brachte erst die Christianisierung der europäischen Gesellschaft. Im Sinne der Caritas (lat.: „Hochachtung“) gründeten viele Kirchengemeinden Wohn- und Pflegeheime für die älteren Menschen aus ärmeren Bevölkerungsschichten.
Altsein heute: Der Lebensabend als aktive Phase
Heutzutage wird das Alter über 60 Jahre oft als eine Zeit des Wandels, der Möglichkeiten und der Vielfalt betrachtet. Menschen außerhalb des Arbeitslebens werden nicht mehr ausschließlich aufgrund ihres Lebensalters definiert, sondern als individuelle Personen mit unterschiedlichen Interessen, Fähigkeiten und Lebenserfahrungen wahrgenommen.
Die Idee des „aktiven Alterns“ hat an Bedeutung gewonnen und ermutigt Senioren dazu, ihren Ruhestand als Phase zu begreifen, in der sie sich noch einmal selbst verwirklichen können. Dabei stehen meist die folgenden Gebiete im Fokus:
Die Welt entdecken
Schon heute buchen Ü65-Jährige jährlich mehr Reisen als Familien. Kein Wunder, denn fernab vom Stress des Berufslebens finden viele erstmals die Zeit, sich interessante Reiseziele und -routen zu suchen. Ein weiterer Faktor: Die Generation der Babyboomer hat deutlich mehr finanzielle Ressourcen als ihre Kinder, welche sie nicht nur vererben wollen, sondern gern für Konsumgüter einsetzt.

Senioren nutzen die Zeit nach dem Berufsleben gerne zum Reisen. | © luciano – stock.adobe.com
Persönliche Interessen verfolgen
Kennen Sie das? Eigentlich hatten Sie sich vor Jahren ein Paar Walkingstöcke, einen Aquarellmalkasten oder ein Angel-Set gekauft, aber sind seitdem nicht dazu gekommen, die Neuanschaffung zu nutzen? Für viele Babyboomer ist ihr Ruhestand die Zeit, in der sie endlich die lang verschobenen Freizeitaktivitäten leben wollen. Der Wunsch nach individueller Freizeitgestaltung geht dabei so weit, dass Großeltern gelegentlich sogar die Betreuung ihrer Enkel ablehnen.
Doch auch der Kontakt mit den Kindeskindern bildet einen wichtigen Punkt der Identität im Alter. Immerhin konnten Studien zeigen, dass die Enkelbetreuung bei Senioren zu einer besseren Fitness und einer höheren Lebenserwartung führt. Natürlich nur dann, wenn die Großeltern ihre Grenzen kennen und nur so viel Arbeit übernehmen, wie sich für sie gut anfühlt.
Sich gesellschaftlich engagieren
Im Alter kann man stärker auf seine eigenen Bedürfnisse achten – umso befriedigender ist es, andere zu unterstützen und zu stärken. Dafür bringen Senioren ein hohes Maß an Lebenserfahrung im Beruf und im sozialen Bereich mit.
Falls Sie sich ehrenamtlich engagieren wollen, bestehen heute diverse Möglichkeiten vom Wahl-Enkel über Mentorenprogramme für Schüler bis hin zur Tätigkeit als Berufsberater. Ein ehrenamtliches Engagement ist außerdem in Umweltschutzorganisationen oder sozialen Organisationen möglich.
Neue Lebensphase – neue Herausforderungen
Für viele Menschen bedeutet der Eintritt in den Ruhestand einen schweren biografischen Einschnitt. Gerade überdurchschnittlich erfolgreiche Menschen leiden dann am Verlust der Tagesstruktur, der beruflichen Kontakte und des sozialen Ansehens. Psychologen sehen hier die Gefahr, dass Frisch-Ruheständler Depressionen entwickeln, und bezeichnen die psychischen Schwierigkeiten rund um den Renteneintritt als Empty-Desk-Syndrom.
Auf die Beziehung kann sich der Wechsel der Lebensphasen ebenfalls einschneidend auswirken: Fast 16 Prozent der Deutschen lassen sich laut Statistischem Bundesamt aktuell nach 25 und mehr Ehejahren scheiden. Die Zahl der Scheidungen der 60- bis 70-Jährigen ist seit den 1990er Jahren von 5 auf 12 Prozent angestiegen.
Ein Grund liegt wahrscheinlich im Bewusstsein, dass man nach Renteneintritt noch mehrere Jahrzehnte aktiven Lebens vor sich hat und sich dafür eine gemeinsame Perspektive wünscht. Insgesamt sollten Senioren ihren neuen Lebensabschnitt nach dem Beruf also nicht nur als Phase der Chancen betrachten, sondern sich außerdem den potenziellen psychischen Herausforderungen bewusst werden.
Altersbilder in verschiedenen Lebensbereichen
Wie unsere Vorstellungen von und die Erwartungen an ältere Menschen aussehen, hängt stark vom jeweiligen Lebensbereich ab:
1. Arbeitswelt
Hier besteht weiterhin eine Polarität: Während Arbeitgeber noch immer dazu neigen, bei ihrer Einstellungspolitik jüngere Bewerber zu bevorzugen, entsteht durch den Renteneintritt der Babyboomer und die zahlenmäßig kleineren Folgegenerationen langsam ein Fachkräftemangel.
Gerade in Berufen, die eine hohe Qualifikation erfordern, wächst daher die Wertschätzung für erfahrene Arbeitskräfte. Viele Senioren nutzen dies, indem sie (ggf. in Teilzeit) jenseits des Renteneintrittsalters weiterarbeiten. Von den aktuell 1,1 Millionen Rentnern, die weiterhin arbeiten, sind dabei nicht alle nur finanziell motiviert.
Eine Anerkennung von Lebensleistungen zeigen zudem Organisationen wie der Senior Experten Service, die hochqualifizierte Fachkräfte im Ruhestand international in Projekte vermitteln. Hier wechselt also das Klischee des Rentners, der beruflich „zum alten Eisen“ gehört, hin zum Menschen, der über lebenslange Erfahrung verfügt.
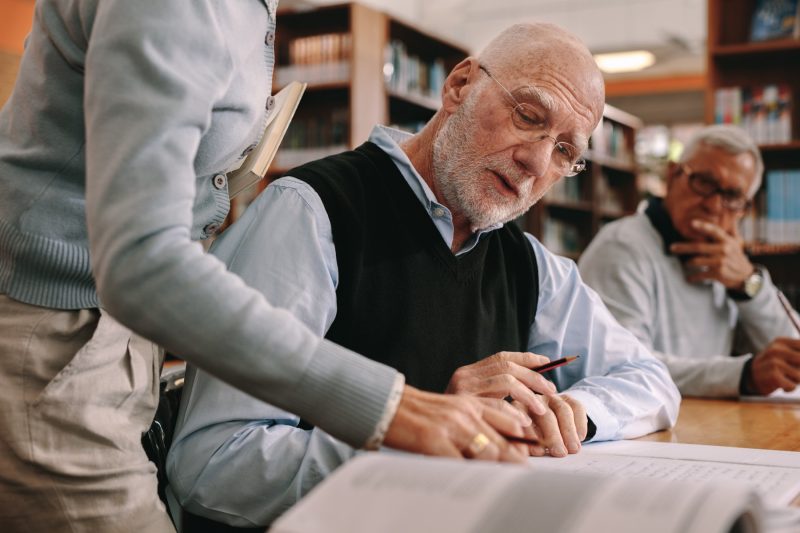
Dank Angeboten wie der Universität des Dritten Lebensalters können sich Menschen auch im Alter noch weiterbilden. | © Jacob Lund – stock.adobe.com
2. Bildung
Heute gilt die Devise, dass ein Mensch lebenslang lernfähig ist. Die Möglichkeit zu Fortbildungen, Weiterbildungen und die Universität des Dritten Lebensalters halten Menschen dazu an, ihr Potenzial auch als Ruheständler weiter zu vergrößern.
Eine wichtige Erkenntnis zum Lernen im Alter hat dabei die Psychologie geliefert: Fachleute unterscheiden hier zwischen der „fluiden Intelligenz“, die gerade jungen Menschen wissenschaftliche Bestleistungen und Innovationen ermöglicht, und der „kristallinen Intelligenz“.
Letztere besteht in den sprachlichen Kapazitäten, den routinierten Problemlösungsfähigkeiten und dem Abstraktions- und Transfervermögen. Im Gegensatz zur fluiden Intelligenz, die sich im Alter reduziert, kann die kristalline Intelligenz sich mit den Jahren noch steigern und bis ins hohe Alter bestehen bleiben.
3. Gesellschaft
Fallen ältere Menschen der Allgemeinheit zur Last? Unsere Gesellschaft basiert auf einem Generationenvertrag, der an sich keine neue Erfindung ist. Denn schon im antiken Rom erhob der Staat Steuern, um Menschen über 60 Jahren mit Brot und Rentenzahlungen zu versorgen. Im Unterschied zu heute war der Anteil der älteren Bevölkerung jedoch bedeutend kleiner.
Allerdings: In dem Maße, wie der demografische Wandel unser Rentensystem ins Wanken bringt, wächst auch der Wunsch nach Teilhabe in der älteren Generation. Das dritte Lebensalter entwickelt sich zu mehreren Dekaden geistiger und körperlicher Fitness, in denen Menschen durchaus einer bezahlten Tätigkeit nachgehen können und wollen.
Darüber hinaus hat die Digitalisierung und der technologische Fortschritt die Lebenswelt älterer Menschen verändert und neue Möglichkeiten für soziale Teilhabe und Kommunikation eröffnet. Ältere Menschen nutzen zunehmend moderne Technologien wie Smartphones, Tablets und soziale Medien, um mit anderen in Kontakt zu bleiben, Informationen zu erhalten und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
Fazit: Altsein fühlt sich heute anders an
Insgesamt zeigen die Veränderungen im Altersbild unserer Kultur eine zunehmende Anerkennung der Vielfalt und Komplexität des „dritten Lebensalters“. Das Ziel muss sein, die Bedürfnisse und Wünsche älterer Menschen zu berücksichtigen und eine inklusive Gesellschaft zu schaffen, die Menschen jeden Alters gleichermaßen respektiert und unterstützt.